
Bild des Monats Mai
2011
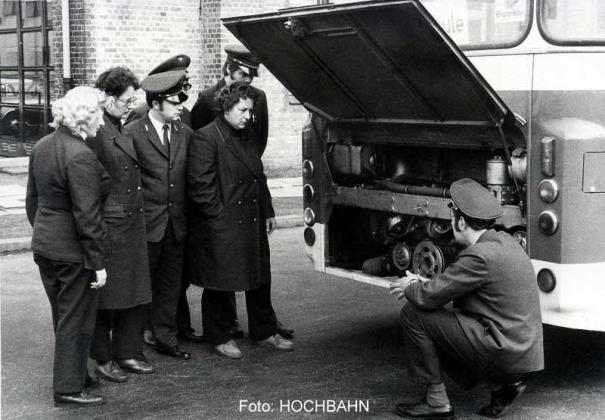
Unser Mitglied wird 100!
Die Hamburger werden seit mehreren Jahren auf das 2012
bevorstehende Jubiläum „100 Jahre HOCHBAHN“ vorbereitet. Gemeint ist damit in erster
Linie die Hamburger U-Bahn, die bis heute von vielen Hamburgern aufgrund ihres
hohen Anteils oberirdisch geführter Streckenteile umgangssprachlich immer noch
als „Hochbahn“ bezeichnet wird. Aber zum Betrieb einer Bahn gehört eine
Betreibergesellschaft. Die Hamburger Hochbahn Aktiengesellschaft (HHA),
seit 2001 auch Mitglied im HOV, wurde hierzu am 27.05.1911 gegründet.
Gründungsgesellschafter waren damals die beiden großen
Elektrizitätsgesellschaften AEG und Siemens, denen damals im Kaiserreich auch in
den anderen deutschen Städten der Bau und Betrieb von elektrischen
Verkehrsmitteln, zumeist Straßenbahnen, übertragen wurde. Hamburg erhielt
damit, nach Berlin, als zweite deutsche Stadt eine U-Bahn.
Dieser Beitrag soll sich nicht mit der umfangreichen
Geschichte der Gesellschaft beschäftigen - diese wird bereits in verschiedenen
Publikationen gebührend dargestellt -, sondern mit den Menschen, die auf
vielfältige Weise zum Gelingen dieses für die Stadtentwicklung Hamburgs
prägenden Verkehrsmittels beigetragen haben. Dieser Beitrag wird sich mit dem
Betriebspersonal, das tagtäglich im „Kundenkontakt“ steht, beschäftigen. Der
Vollständigkeit halber darf natürlich nicht das technische und kaufmännische
Personal unerwähnt bleiben, das für den täglichen reibungslosen Betriebsablauf
und einen effizienten Mitteleinsatz steht. Dadurch gelang es der Gesellschaft
über Jahrzehnte hinweg Überschüsse und heute einen im Bundesvergleich
hervorragenden Kostendeckungsgrad zu erzielen.
In den ersten Jahren der HHA bevorzugte die Verwaltung das
Einstellen von Personal, das beim Militär gedient hatte. Entsprechend
militärisch ging es auch im täglichen Betrieb zu. Der Ausbruch des I.Weltkriegs
1914 bedeutete daher eine erste Zäsur für die noch junge Gesellschaft. Das „gediente
Personal“ wurde in großer Zahl zum Kriegsdienst eingezogen und die
Todesanzeigen für die Gefallenen fielen in den Geschäftsberichten der
Folgejahre immer umfangreicher aus. Trotz anfänglicher Skepsis konnte durch den
Einsatz von Frauen, auch in körperlich anstrengender Tätigkeit, der Betrieb,
der kriegsbedingt noch ausgeweitet werden musste, weitgehend aufrechterhalten
werden. Mit der Beschäftigung von Frauen bildete die HHA im Kaiserreich aber
damals keine Ausnahme.
Der verlorene Weltkrieg und die revolutionäre Stimmung in
der jungen deutschen Republik führten sehr schnell zu Streiks für bessere
Arbeitsbedingungen, so auch bei der HHA. Neben höheren Löhnen und der
Einführung des Achtstundentags gelang es, den militärischen Umgangston beim
Betriebspersonal und die beim Personal verhassten Mützennummern abzuschaffen.
Für die zahlreichen Kriegsheimkehrer hatten die Frauen aber jetzt wieder
weitgehend zu weichen. 1918 war aufgrund staatlicher Intervention die HHA zu
einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen mit Staatsbeteiligung geworden. Das
Personal der Betriebszweige Straßenbahn und später Alsterschifffahrt kam so
hinzu. Seit 1921 befand sich auch der Autobusbetrieb der HHA im Aufbau. Der
Personalbestand der Gesellschaft vergrößerte sich so schlagartig. Doch es
sollte noch lange dauern, bis es zu einem Zusammenwachsen der verschiedenen
Betriebszweige kam. Aber die Grundlagen für die „Hochbahner-Familie“ waren
geschaffen, folgten doch später Kinder von Hochbahnern ihrem Elternteil in die
Gesellschaft, so dass es heute Hochbahner in der x-ten Generation in den
verschiedenen Sparten dieses großen Nahverkehrsunternehmens gibt.
Das Leben in Deutschland und in Hamburg war im 20.
Jahrhundert immer wieder von Krisen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt,
durch Engagement, Pflichtbewusstsein und Improvisation der HHA-Mitarbeiter
gelang es, den Alltag in der Millionenstadt weitgehend in geordneten Bahnen
verlaufen zu lassen. Technischer Fortschritt und geänderte Vorschriften
erleichterten dem Fahrpersonal zunehmend seinen harten Dienst. Für lange Zeit
war aber aus verschiedenen Gründen das Ansehen der HHA bei den Hamburgern eher
spannungsgeladen. Hierzu beigetragen haben dürfte auch der rauhe Umgangston
zwischen Betriebspersonal und dem über Jahrzehnte als „Beförderungsfall“
angesehenen Fahrgast. Auch wenn die HHA mit neuen Verkehrsangeboten wie
„Schnellbus“ und „Citybus“, mit neuen Fahrzeugen und dem engagierten Einsatz
für die Gründung des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) immer wieder versuchte,
mehr Nachfrage für ihre Verkehrsmittel zu erzeugen, so wurde doch bei
ausufernden Kosten und politischer Vorgabe zur Defizitreduzierung lange Zeit
immer wieder mit Angebotsreduzierung und Fahrpreiserhöhungen reagiert und damit
oft eine „Abwärtsspirale“ mit sinkenden Fahrgastzahlen in Gang gesetzt. Ein
allmähliches Umdenken begann zu Beginn der 1980er-Jahre. Erst 1983 wurde im HVV
der „Beförderungsfall“ zum „Fahrgast“. Das Personal schulte man im
kundenorientierten Umgang und durch gezieltes Marketing umwarb man den potentiellen
Fahrgast.
Trotzdem stieg in den Folgejahren das Defizit der HHA und
den übrigen im HVV organisierten Nahverkehrsunternehmen weiter. Der Senat,
insbesondere nach Eintritt der FDP in die Regierung, verschärfte deswegen seine
Sparvorgaben. Die HHA reagierte darauf u.a. mit der Verlagerung von
Busleistungen auf Fremdunternehmen, dem Verkauf von ertragreichen
Tochtergesellschaften, der Verringerung des Busbestands und 1988 mit der
Schließung des Busbetriebshofs Schützenhof in Altona. Mit Verringerung der
bisher bezahlten Aufrüstzeiten im Betriebsdienst und einem neuen
Vergütungssystem wurde auch Sparbemühungen beim Personal eingefordert.
Und zum Sommerfahrplan 1989 kam es erneut zu Verringerungen im Leistungsangebot
des HVV außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Massive Proteste der Fahrgäste, des
Personals und der Gewerkschaften, eine geänderte Wahrnehmung des motorisierten
Individualverkehrs, aber auch die Öffnung der innerdeutschen Grenze, die die
Randlage Hamburgs in der Bundesrepublik beendete, brachten ein Umdenken in der
Politik, insbesondere bei der mitregierenden SPD. Anfang 1990 entwickelten
Senat und Bürgerschaft Mehr-Punkte-Programme um die Attraktivität des ÖPNV in
Hamburg zu verbessern. So kam es u.a. zu Verbesserungen im Betriebsablauf im Oberflächenverkehr
durch weitere Busspuren und optimierte Ampelschaltungen, allerdings nur in
ausgewählten Bereichen. Das Verkehrsangebot wurde wieder ausgeweitet und durch
verschiedene Marketingmaßnahmen abgesichert. Ein Erfolg mit steigenden
Fahrgastzahlen stellte sich ein. Auch die Wiedereinführung der Straßenbahn in
einer modernen Form wurde nun ein Thema der Oppositionsparteien GAL und CDU,
aber später auch der SPD.
Die HHA forcierte ihre seit Jahrzehnten verfolgten
Bemühungen zur Rationalisierung im Unternehmen, um so den Kostenanstieg und das
Gesamtdefizit zu begrenzen. Das bedeutete für das Personal, insbesondere im
Betriebsdienst von Bus und U-Bahn, harte Einschnitte, auf lieb gewordenes
musste verzichtet werden, aber es gab auch Verbesserungen durch Rückholung von
bisher fremd vergebenen Verkehrsleistungen im Bussektor und dem Verzicht auf
betriebsbedingte Kündigungen. Proteste blieben natürlich nicht aus. Ab Mitte
der 1990er-Jahre stellten sich Erfolge in Form einer Steigerung des
Kostendeckungsgrads und erhöhter Fahrgastzahlen ein und es gelang durch
vielfältige innerbetriebliche Maßnahmen, die Mitarbeiter von der Notwendigkeit
des eingeschlagenen Kurses (weitgehend) zu überzeugen und sie auf dem Weg zu
einer verbesserten Wirtschaftlichkeit und einem geänderten Kundenbewusstsein
als Dienstleister mitzunehmen.
Dadurch wurde es möglich, die HHA auch noch nach hundert
Jahren als größter Anbieter von Nahverkehrsleistungen in Hamburg zu erhalten
und auf neue EU-Vorgaben vorzubereiten. Über ihre Tochtergesellschaft „BENEX“
ist die HHA heute zu einem „Nationalplayer“ auf dem deutschen Verkehrsmarkt
geworden, um so als einer der größten Arbeitgeber Hamburgs Arbeitsplätze in
dieser Region zu sichern. Ende 2009 arbeiteten 4.413 Personen für die HHA,
davon im Bereich Betrieb und Infrastruktur 3.466, davon 355 weiblich.
Die Mitarbeiter der HHA haben die verschiedensten
Qualifikationen. Neben anerkannten Berufsabschlüssen in Ausbildungsberufen
werden insbesondere Mitarbeiter im Fahrdienst auf ihre Tätigkeit intensiv
vorbereitet, ohne jedoch dabei einen anerkannten Ausbildungsabschluss zu
erhalten. Erst seit Dezember 1975 haben Busfahrer in berufsqualifizierenden
Kursen die Möglichkeit, sich weiterzubilden und so den Abschluss als
„Berufskraftfahrer“ zu erwerben. Hiervon wurde in der Folgezeit immer mehr
Gebrauch gemacht.
Unser Bild des Monats zeigt eine Gruppe von sechs
angehenden Busfahrern mit ihrem Fahrlehrer Horst Winter im Frühjahr 1972
auf dem Betriebshof Langenfelde vor dem Motor eines Daimler-Benz O
305 der zweiten Serie (Fahrschulwagen 1109) bei ihrer dreimonatigen
Ausbildung. Der HOV erhält in seiner Sammlung verschiedene Fahrzeuge dieses für
die 1970er und 1980er in Hamburg prägenden Bustyps, mit Wagen 1071 auch ein
Fahrzeug aus dieser zweiten Serie.
Seit 1921 hat die HHA eine eigene Fahrschule für Busfahrer.
Neben der Vermittlung der Grundlagen für die Fahrgastbeförderung mit Bussen
wird auch Technik und natürlich Tarifkunde vermittelt, weil seit Ende der
1950er Jahre keine Schaffner mehr in den Bussen der HHA mitfahren und der
Busfahrer das Kassiergeschäft übernommen hat. Auf diesem Foto sieht man auch
die ersten drei Frauen, die bei der HHA zu Busfahrerinnen geschult worden sind.
In der alten Bundesrepublik war damals die HHA hier Vorreiter bei den Nahverkehrsunternehmen.
Durch die Änderung einer Verordnung von 1940 ist es seit 1972 erlaubt, auch
Frauen im Busfahrdienst einzusetzen. Zu dieser Zeit war das in vielen
europäischen Ländern aber bereits gelebte Wirklichkeit. Bei der HHA nutzten nun
Frauen, die vorher als Fahrerinnen oder Schaffnerinnen bei der Straßenbahn
eingesetzt waren, diese Möglichkeit zum Umstieg. Für die HHA ergab sich so eine
weitere Möglichkeit dringend benötigtes Fahrpersonal zu erhalten. Zu dieser
Zeit waren die Bemühungen der HHA, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Personal zu
gewinnen, wenig erfolgreich. Viele Hamburger werden sich noch daran erinnern,
dass damals bei Bus und Straßenbahn aus Jugoslawien angeworbenes Personal tätig
war.
Alle Mitarbeiter tragen noch die schwere graue Stoffuniform mit den bis 1973 gebräuchlichen Abzeichen. Zum geänderten Erscheinungsbild der Gesellschaft und ihrer Mitarbeiter gehört seit Jahren eine zeitgemäße Bekleidung. Für 2011 ist erneut eine Umstellung bei der Dienstbekleidung vorgesehen.
Text:Lutz Achilles / HOV