
Bild des Monats August
2014
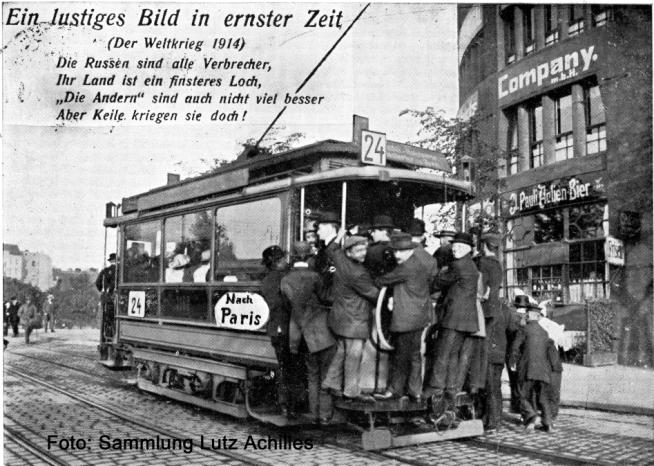
Der Erste Weltkrieg und seine
Auswirkungen auf den Nahverkehr in Hamburg
Unser
Bild des Monatserinnert an die Fehleinschätzung der Verantwortlichen, den
Konflikt nach wenigen Monaten siegreich zu beenden, schließlich wollten alle
Weihnachten wieder zu Hause sein. Die Ansichtskarte zeigt einen Triebwagen der Linie 24 in der Spaldingstraße vor dem Anckelmannplatz.
Das Gebäude mit seiner gerundeten Fassade existiert an dieser Stelle noch
heute. Als Fahrtziel wird Horn gezeigt, obwohl zu dieser Zeit bereits Schiffbek
(heute Billstedt) der Linienendpunkt war. Die im Mai 1914 eröffnete Teilstrecke
stellte für die Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft
(SEG) die letzte Streckenverlängerung in Friedenszeiten dar. An der Seite
wird das Ziel „Paris“ gezeigt, obwohl der Straßenbahnwagen sich in Richtung
Osten bewegt. Aber das Hauptziel der Militärs war es damals,den „Erbfeind
Frankreich“ schnell zu besiegen und auch Paris zu erobern, was im letzten Krieg
1870/71 nicht gelang. Danach sollte wieder Frieden sein – zu Bedingungen des
Siegers. Das deutsche Kaiserreich erklärte deswegen am 1.8.1914 Russland und am
03.08.1914 Frankreichden Krieg. Die Umsetzung des „Schlieffen-Plans“
führte zur Verletzung der Neutralität
von Belgien und der Niederlande und damit zum Kriegseintritt von Großbritannien
am 04.08.1914. Der unerwartete Einmarsch von zwei russischen Armeen des
Zarenreichs nach Ostpreußen brachte bereits im August 1914 die von der
Heeresleitung gefürchtete zweite Front
im Osten des Kaiserreiches.Da der Zar, verwandt mit Kaiser Wilhelm II, bereits
am 30.07.1914 die Mobilmachung verkündete, galt er aus deutscher Sicht als
Aggressor. Der Spruch auf dieser Ansichtskarte spiegelte damals die Meinung
weiter Teile der Bevölkerung wider. Für das mit dem deutschen Kaiserreich
verbündete Kaiserreich Österreich-Ungarn gab es eine Abwandlung auf die Serben,
deren Garantiemacht Russland war. Interessant an dieser am 27.10.1914
abgestempelten Ansichtskarte ist auch die Bezeichnung „Der Weltkrieg 1914“,
hieß der Konflikt doch zunächst „Der Große Krieg“. Allerdings hatten Frankreich
und Großbritannien schon nach kurz nach Beginn der Kampfhandlungen die
deutschen Kolonien in Übersee angegriffen, so dass aus diesem anfänglich
europäischen ein weltweiter Krieg geworden war.
Unter
Führung des schon pensionierten Paul von Hindenburg und Erich von Ludendorff
gelang es im Spätsommer 1914, die russischen Truppen zu schlagen. Obwohl die
Entscheidungsschlacht in der Nähe von Ortelsburg stattfand, wurde Hindenburg
zum „Helden von Tannenberg“, um so eine Niederlage des Deutschen Ordens gegen
die Polen vor 500 Jahren symbolisch zu tilgen. Damit wurde ein Mythos geboren,
deren Exponenten später unheilvoll in die Entwicklung der Weimarer Republik und
den Aufstieg des Nazireichs einwirkten. Rund 100.000 Russen gerieten damals in
Kriegsgefangenschaft, sie wurden völkerrechtswidrig für Arbeiten im Kaiserreich
eingesetzt, so auch beim Bau der Walddörferbahn und der Langenhorner Bahn in
Hamburg.
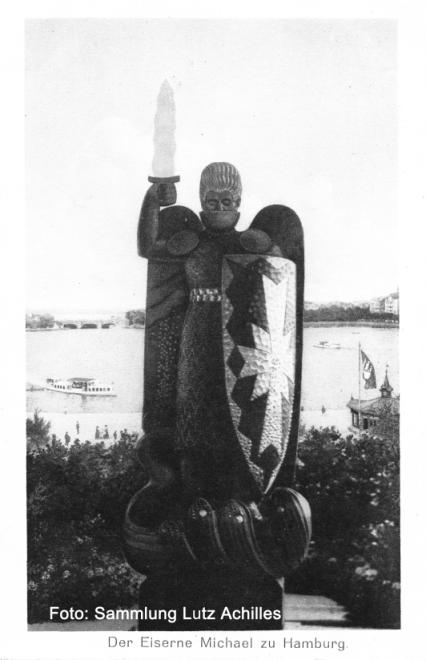
Eine
andere Ansichtskarte zeigt ebenfalls ein patriotisches Motiv, den „Eisernen Michel“ auf dem Jungfernstieg, im Hintergrund der
Alsterdampfer-Anleger. Um die Solidarität und die Verbundenheit der Heimat mit
den Frontsoldaten zu verstärken,wurde die Bevölkerung ab 1915 zu „Nagelungen“
aufgerufen. Hierfür konnten Nägel aus Kupfer, Eisen und Messing erworben werden
und in eine Holzfigur oder ein –symbol geschlagen werden. Hamburg tat sich hier
mit einer 12 Meter hohen Hindenburg-Statue reichsweit hervor. Die Erlöse aus
dieser Aktion dienten der Unterstützung von Familien gefallener Soldaten.
Wachsende Kriegsmüdigkeit und die alltäglichen Probleme in der Heimat machten
dieser Aktion 1917 ein Ende.
Für
die SEG mit ihrem ausgedehnten Straßenbahnnetz in den vier Städten Altona,
Hamburg, Wandsbek und Harburg brachen schwierige Zeiten an. Die im
Jahresbericht 1913 der SEGfür Altona als zukunftsweisend angekündigten neuen
Straßenbahnstrecken im Raum Othmarschen und Bahrenfeld konnten mit Ausbruch des
Krieges nicht mehr umgesetzt werden. Auch brachen jetzt die Fahrgastzahlen im
Vergleich mit den ersten sieben Friedensmonaten 1914 ein. Die Verhandlungen mit
Hamburg über die Verlängerung der Konzession für den Straßenbahnverkehr stoppte
und vertagte man auf die Zeit nach dem Friedensschluss. Keiner ahnte damals,
dass die SEG bis zu diesem Zeitpunkt ihre Selbständigkeit verloren haben würde. Bereits zu Beginn der Mobilmachung im
August 1914 verlor die SEG rund 2.300 Betriebsangestellte, meist ehemalige
Militär-Gediente. Davon war ein großer Teil des Lehr- und Aufsichtspersonals
betroffen, die Einarbeitung von neuem Personal, wenn es denn gewonnen werden
konnte, wurde dadurcherschwert. Die Folge war, dass der Betrieb zunächst
eingeschränkt werden musste. Durch Mehrarbeit der verbliebenen Mitarbeiter
konnte das Verkehrsangebot zunächst wieder ausgeweitet werden, weitere
Einberufungen machten diese Bemühungen aber schnell zunichte. Der Jahresbericht
von 1914 vermerkte u.a., dass zehn Pferde vom Militär beschlagnahmt und eine
größere Anzahl von Uniformmänteln an das Militär abgegeben wurden. Als im
Interesse der Landesverteidigung stehend sah der Vorstand der SEG die Freifahrt
von Soldaten in Uniform, sowie des Roten Kreuzes und der Kriegshilfe an. Dazu
zählte auch die Unterstützung der Angehörigen der einberufenen ehemaligen
Angestellten. Alle Maßnahmen verschlechtertenaber das Jahresergebnis der
Gesellschaft.

Die
zur SEG gehörende Wagenbauanstalt
Falkenried baute 1914 auf eigene Kosten einen aus Kraftwagen und einem
Anhänger bestehenden Zug für die
Verwundetenbeförderung. Vom Kriegsgebiet im Westen trafen immer mehr
Transporte mit schwer und schwerst Verwundeten am Harburger Bahnhof ein. Das
Fahrzeug stand dort für den Weitertransport in die Lazarette bereit. Unser Foto
zeigt diesen Zug für 18 liegende und 40 sitzende verwundete Soldaten auf dem
Werksgelände in Eppendorf. Den Bau eines zweiten Transportzuges belegt ein
anderes Fotodokument.
Der
Personalmangel dauerte auch 1915 an. Die Arbeiten an den Fahrzeugen und Anlagen
wurden auf das für die Betriebssicherheit unbedingt Notwendige beschränkt. Der
durch die Seeblockade Großbritanniens völlig unterbundene Überseehandel führte
zu einem Personalabbau im Hafen und damit auch zu weniger Berufsverkehr. Auch
wenn nicht im Jahresbericht zunächst nicht explizit genannt,übernahmen nun
verstärkt Frauen die Aufgaben der vormals männlichen Angestellten im
Fahrdienst.

Unser
Foto zeigt 1914einen Straßenbahnzug der Linie 36 am Eimsbütteler
Marktplatz „in Frauenhand“. Üblicherweise hatte ein Zwei-Wagenzug drei
Personen als Personal. Zum Gruppenbild muss noch weiteres Personal getreten
sein. An der Kurbel stand Frau Helma Schröder. Und alle Frauen trugen die beim
Personal, unabhängig vom Geschlecht, unbeliebte Mützennummer. Erst im Jahresbericht
1916 findet sich die Notiz, dass der Abgang von männlichen Angestellten „durch
weibliche Kräfte, mit denen wir im allgemeinen günstige Erfahrungen gemacht
haben“, kompensiert wurde. Die Fahrgastzahlen verzeichneten wieder einen
Anstieg.
Die
im Westen zu einem Stellungs- und Abnutzungskrieg gewordenen Kampfhandlungen
erforderten immer mehr neue Waffen und Munition. Das bedeutete für die Heimat
die Umstellung der Industrieproduktion auf Kriegsproduktion. Für diese
Neuorganisation der deutschen Kriegswirtschaft und Rüstungsproduktion
zeichneten von Hindenburg und Ludendorff mit dem „Hindenburg-Programm“ vom
26.08.1916 verantwortlich. Es galt, alle Personal- und Materialreserven hierfür
zu gewinnen. Um die Umstellung der Produktion für die Unternehmen zu
erleichtern, wurden die Preise freigegeben. Ein Preisschub war die Folge – auch
für die SEG bedeutete das erhöhte Beschaffungskosten.
1916
zwangen Probleme mit der Stromerzeugung zu Betriebseinschränkungen. Um für das
Hamburgische Kriegsversorgungsamt Lebensmitteltransporte durchzuführen, wurde
das Straßenbahnnetz in geringem Umfang erweitert, um so Großbäckereien in der
Hamburger Straße und der Conventstraße anzuschließen. Die Straßenbahn diente
mit dem Gütertransport „dem vaterländischen Interesse“. Die hierfür benötigten
Spezialwagen lieferte Falkenried. Trotzdem verschlechterte sich die
Versorgungslage der Bevölkerung zusehends. Erste Hungeraufstände folgten. Und
der berüchtigte Steckrübenwinter im harten Winter 1916/17 stand der Bevölkerung
in der Heimat noch bevor.
Die
noch junge Hamburger Hochbahn AG (HHA) verlor
ebenso wie die SEG rasch nach Kriegsbeginn 62 % der Angestellten und 73 % aus
dem Verkehrsdienst an die Armee. Auch die HHA gewährte Unterstützungsleistungen
an die Angehörigen der einberufenen Mitarbeiter. Und es galten Freifahrten für einen vergleichbaren
Personenkreis wie bei der SEG. Die Verkehrsentwicklung ist mit derjenigen bei
der SEG vergleichbar. Die letzte Zweiglinie vom Grundnetz, die Strecke vom
Hauptbahnhof nach Rothenburgsort, konnte am 27.07.1915 in Betrieb genommen
werden. Die Arbeiten an der von Hamburg finanzierten Langenhorner Bahn und der
Walddörferbahngingen – wie oben dargestellt –mit russischen Kriegsgefangenen
weiter.

Weitere
Einberufungen männlicher Mitarbeiter machten „die Einstellung von Frauen und
Kriegsbeschädigten in den äußeren Verkehrsdienst erforderlich“, so der
Geschäftsbericht von 1915. Das bedeutete für die Frauen auch harte Arbeit in
der Streckenunterhaltung. Unser Foto zeigt eine gemischte „Arbeitsrotte“ von Frauen und Männern bei Stopfarbeiten
an der neuen Strecke nach Rothenburgsort.
Rechts die Gleise der Bahnstrecke nach Bergedorf. Der Geschäftsbericht 1916
gibt an, dass 98 % der männlichen Mitarbeiter im Verkehrsdienst mittlerweile
einberufen war. Der Mangel an gelernten Arbeitern führte zu einem Rückstand bei
den Unterhaltungsarbeiten am Wagenpark. Die Beschäftigung von Frauen wurde
ausgeweitet, u.a. taten sie als Zugfahrerinnen Dienst.
Erstmals
erschien im Geschäftsbericht 1915 eine Namensliste
der Gefallenen.
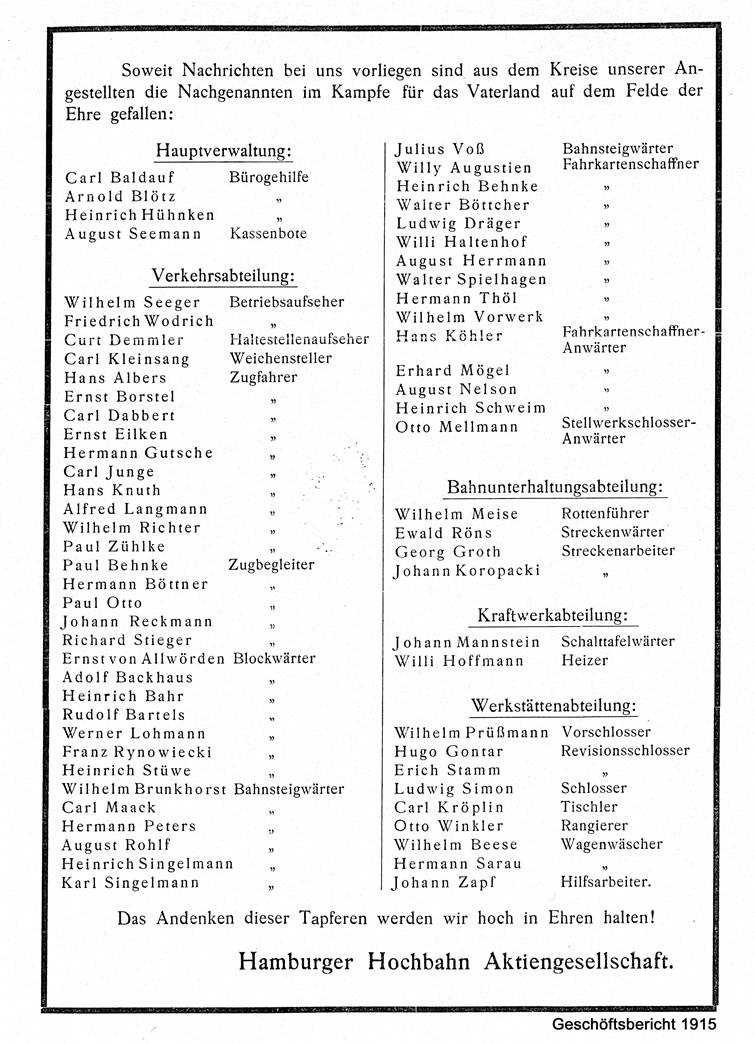
Trotz
steigender Fahrgastzahlen sank die Rentabilität des Unternehmens. Die
schlechtere Versorgung mit Brennstoffen machte 1917 Betriebseinschränkungen
erforderlich. Auf Anregung des Hamburgischen Staatesbegannen 1917
Verhandlungen, um die HHA künftig – bei erweitertem Aufgabengebiet - als
„gemischtwirtschaftliches Unternehmen“ zu führen. Hoffnungen der SEG auf eine
Verlängerung ihrer Konzessionen (in Selbständigkeit) zerschlugen sich endgültig.
Die Verschmelzung der SEG auf die HHA erfolgte rückwirkend zum 01.01.1918.
Damit entstand – am Ende des Kriegs – das größte Nahverkehrsunternehmen im
Kaiserreich.
1918
stellte sich angesichts der Dauer des Konflikts sowie erdrückender Übermacht
der Alliierten an Waffen und Soldaten Kriegsmüdigkeit bei den deutschen
Soldaten und in der Bevölkerung ein. Auch setzten sich Soldaten vermehrt von
der Truppe ab. Hinzu kam 1918 die „Spanische Grippe“, die damals größte
Pandemie in Europa mit 35 Millionen an Opfern. Die militärische Niederlage
Deutschlands zeichnete sich im Laufe des Jahres 1918 ab. Die Abdankung des
Deutschen Kaisers Wilhelm II.und dessen Gang ins Exil führte am 09.11.1918 zur
Revolution, der Ausrufung der Republik und zu unruhigen Zeiten – auch für die
HHA. Streiks brachten aber eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, höhere
Löhne und die Abschaffung der auch beim HHA-Personal ungeliebten Mützennummer.
Auch wenn in den Jahren nach Kriegsende wieder weniger Frauen einem Beruf nachgingen,
war ein Ergebnis der Demokratisierung in Deutschland das Wahlrecht für Frauen
und deren verfassungsmäßige Gleichstellung.
Text: Lutz Achilles / HOV