
Bild des Monats
November 2015

60 Jahre Schnellbus in Hamburg
Im II. Weltkrieg war die Verkehrsinfrastruktur in Hamburg, wie in vielen anderen Städten auch,
stark zerstört worden. Der Mangel prägte die ersten Nachkriegsjahre und schränkte
den Wiederaufbau ein. Betriebsanlagen mussten wieder errichtet werden,
viele Fahrzeuge waren zerstört oder
durch die hohe Beanspruchung stark verschlissen. 1952 konnte die HOCHBAHN den
Wiederaufbau weitgehend abschließen. Nun war es möglich, das Verkehrsnetz
auszubauen und neue Verbindungen zu schaffen.
In der Mitteilung Nr. 9 des Senats an die Bürgerschaft vom
07.01.1955 berichtete der Senat von dem Plan der HOCHBAHN,
„Omnibus-Zusatz-Linien“ einzurichten, um dem erwarteten Verkehrsbedürfnis nach
„schnellen und bequemen Verbindungen der Außenbezirke mit dem Stadtkern“ und
weiterer „Querverbindungen zwischen den Außenbezirken der Stadt“ nachzukommen.
Der Senat führte aus: „Diese Zusatz-Linien sollen nicht dem üblichen
Massenverkehr dienen, sondern begehrte Verkehrsziele schneller und bequemer
erreichen lassen, als dies mit normalen Verkehrsmitteln möglich ist, weil die
Sonderbusse ihre Verkehrsziele auf kürzestem Wege erreichen und nur an einigen
wenigen Hauptverkehrsknotenpunkten halten. Diese Schnell-Linien heben sich
daher stark von dem Normalverkehr ab und nähern sich leistungsmäßig dem
individuellen Kraftverkehr, so dass sie zu einer Entlastung der Innenstadt von
dem Individualverkehr beitragen, da der Autofahrer mittels solcher Linien fast
ebenso schnell in die Innenstadt gelangen kann wie mit seinem eigenen
Kraftwagen“. Der Vergleich mit dem eigenen Kraftwagen bedeutete für den
Fahrgast nahezu eine „Sitzplatzgarantie“ wie sie bei der elektrischen S-Bahn in
der 1. Klasse auch bestand.
Auch wenn heute feststeht, dass die erhoffte Entlastung der
Innenstadt vom Autoverkehr nicht gelang, die ehemals schnellen Omnibuslinien
vom Individualverkehr heute tagtäglich ausgebremst werden, viele Politiker den
bis heute unverändert erhobenen Zusatztarif nicht mehr als gerechtfertigt
ansehen und dadurch diese Hamburger Besonderheit überlebt erscheint, wollen wir
mit unserem Bild des Monats an „60 Jahre Schnellbus in Hamburg“ erinnern.
Die HOCHBAHN beabsichtigte folgende als „Schnell-Busse“
bezeichnete Zusatzlinien einzurichten:
Blankenese – Elbchaussee – Altona – ZOB
Rahlstedt – Tonndorf – Wandsbek – ZOB
Schnelsen – Niendorf – Lokstedt – ZOB
Flughafen – Alsterdorf – Winterhude –
ZOB
Hauptbahnhof – Stephansplatz –
Landungsbrücken – Meßberg – Hauptbahnhof
Hinzukam noch die als „Querlinie in den Außenbezirken“
bezeichnete Strecke
Stellingen – Lokstedt – Eppendorf –
Alsterkrug,
die später in das Schnellbussystem eingegliedert wurde.
Die weiteren Zusatzlinien betrafen eine Freihafenlinie und eine
Klein-Bus-Linie für Moorwerder. Diese sollen hier nicht weiter betrachtet
werden.
Der Begriff „Schnellbus“ war für Hamburg damals keine neue
Wortschöpfung, weil schon die VHH (BGE) zwischen 1953 und 1956 ihre auf der
Linie 1 (Hamburg, Hauptbahnhof - Lauenburg) in den Hauptverkehrszeiten in
Lastrichtung durch Auslassen von
Zwischenhaltestellen verkehrenden Busse so bezeichnete. Bereits am 18.02.1952
hatte die Deutsche Bundesbahn einen Schnellbus zwischen Hamburg, ZOB und
Harburg, Rathaus eingerichtet. Auch in anderen Städten der Bundesrepublik
wurden zu dieser Zeit entsprechend bezeichnete Schnellverbindungen
eingerichtet. Die Hamburger Besonderheit besteht aber bis heute darin, dass
diese Linien nur innerstädtisch verkehren (Ausnahme VHH-Linie 31) und ein
eigenständiges Verkehrsnetz bilden.
Die HOCHBAHN erwartete für diese Zusatzlinien höhere
Betriebskosten, so dass Senat und
Bürgerschaft vom HOCHBAHN-Tarif abweichende (höhere) Fahrpreise genehmigen
sollten. Dieser höhere Tarif erschien gerechtfertigt aufgrund des im Vergleich
mit der Straßenbahn und den Omnibuslinien zum Normaltarif höheren Komforts und
der erwarteten größeren Schnelligkeit. Weil Straßenbahn- und andere
Omnibuslinien weiter als Alternative bereitstanden, hatte der Senat keine sozialpolitischen
Bedenken gegen diese Fahrpreisgestaltung.
Die seit 1918 unter staatlicher Kontrolle stehende Hamburger
Hochbahn AG hatte sich seitdem gemäß § 10 der Verleihungsurkunde die Fahrpreise
von Senat und Bürgerschaft genehmigen zu lassen. Diese Verpflichtung besteht
bis heute - auch in Zeiten des Hamburger Verkehrsverbunds - fort.
Die HOCHBAHN erwirtschaftete damals noch Gewinne, wenn auch
in geringer Höhe und richtete die Tarifgestaltung der Zusatzlinien nun daran
aus, den Betrieb weitgehend kostendeckend betreiben zu können. Insoweit
wünschte sich die HOCHBAHN eine größere Beweglichkeit in der Tariffestsetzung.
Dies veranlasste den Senat bei der Bürgerschaft zu beantragen, künftig als
Senat allein für Genehmigung der Tarife für die Zusatzlinien verantwortlich zu
sein. Am 09.03.1955 stimmte die Bürgerschaft den Plänen für Zusatzlinien zu,
gestattete dem Senat aber nur im ersten Betriebsjahr die Tarife jeder dieser
Omnibuslinien ohne Mitwirkung der Bürgerschaft zu genehmigen.
Danach konnte die HOCHBAHN an die Umsetzung ihrer Pläne
gehen, um mit dem SCHNELLBUS – nördlich der Elbe - für weite Teile von Hamburg
Omnibuslinien einzurichten, die folgende Anforderungen zu erfüllen hatten:
-
Direktverbindung
von den Außenbezirken in die Innenstadt
-
Hohe
Reisegeschwindigkeit durch wenige Unterwegshaltestellen
-
Omnibusse
mit gehobener Ausstattung
-
Ausgesucht
freundliches Fahrpersonal
Die am 30.10.1955 eröffnete Linie 36 war Hamburgs erste
Schnellbuslinie, die die o. g. Kriterien erfüllte. In 36 Minuten Fahrzeit
konnte man vom vornehmen Elbvorort Blankenese zum Hauptbahnhof / ZOB, Bussteig
5 gelangen. Das gelang nur, indem man die Anzahl von Haltestellen gering hielt,
auch behinderte der Individualverkehr – im Gegensatz zu heute – den Busverkehr
damals nur gering. Selbstverständlich verkehrten die Omnibusse ohne Schaffner
im Einmannbetrieb. Unser Bild des Monats zeigt den Bus HHA 295, später 6209 (Daimler-Benz O 321 H, Baujahr 1955,
1. Schnellbusserie) am Eröffnungstag
am Bahnhof Blankenese. Mit dem Wagen
6495 hat der HOV den 11. Bus aus der 1. Stadtbusserie in seiner Sammlung,
allerdings ohne Dachrandverglasung.
Bereits am 03.07.1955 nahm die HOCHBAHN die in der
Senatsvorlage als „Querlinie“ bezeichnete Verbindung von Stellingen über
Eppendorf zur Luftwerft als Linie 91 in Betrieb. Für diese Sonderlinie galten
vom späteren Schnellbus-Tarif abweichende Fahrpreise. Auch wenn es sich dabei
um den Beginn der heutigen Schnellbus-Linie 39 handelt, wurde diese Linie
anfangs noch nicht als Schnellbus, sondern als Sonderlinie bezeichnet.
Während man den Schnellbussen die ehemals von der Straßenbahn genutzten 20er
und 30er-Liniengruppen vorbehielt, bekamen die Sonderlinien die 90er-Nummern
zugeordnet.
In der Senatsmitteilung 386 vom 30.11.1956 zog man eine
erste Bilanz der Zusatzlinien. Während das Betriebsergebnis der
Schnellbus-Linie „die Erwartungen erfüllte“ – also wohl mindestens
kostendeckend war -, lag der Kostendeckungsgrad der anderen 1955 beantragten
Linien unter den Erwartungen: Für die Linie 91 betrug dieser immerhin 84,5 %,
die Kleinbus-Linie 93 und die Freihafenlinie 94 fuhren nur 36 % bzw. 24 % ihrer
Kosten ein. Tariferhöhungen sollten hier Abhilfe schaffen. Der Tarif der Linie
91 wurde dem Schnellbus-Tarif angeglichen. Am 16.01.1957 stimmte die Bürgerschaft
der Erhöhung für die Linie 91 zu. Der
Betrieb der Freihafenlinie endete am 31.01.1957 wegen Unwirtschaftlichkeit.
Eine Besonderheit stellte die auf besonderen Wunsch des
Magistrats der Stadt Wedel (Mitteilung 327 vom 02.12.1955) im Sommerfahrplan
1956 versuchsweise eingerichtete Nachtschnellbuslinie 37 von Ottensen,
Bleickenallee (Anschluss von der Nachtstraßenbahnlinie 6) nach Wedel (und bei
Bedarf nach Schulauer Fährhaus) über Blankenese – Rissen dar. Damit sollte die
nächtliche Betriebspause der S-Bahn
überbrückt werden. Die Nachfrage blieb gering, bereits am 29.10.1956
entfiel dieses Angebot wieder.
Das Fahrgastaufkommen der Linie 36 entwickelte sich
erfreulich, so dass in der Mitteilung 387 vom 30.11.1956 um die Genehmigung zur
Einrichtung weiterer Schnellbuslinien zur Entlastung von normaltariflichen
Straßenbahn- und Omnibuslinien nachgesucht wurde.
Bevor am 22.12.1956 mit der Linie 32 die zweite
Schnellbuslinie den Betrieb aufnahm, gab es bei der Linie 36 erste
Veränderungen. Am 30.10.1956, also ein Jahr nach dem erfolgreichen Start, wurde
die Linie 36 innerhalb von Blankenese nach Frenssenstraße / Rissenener
Landstraße verlängert.
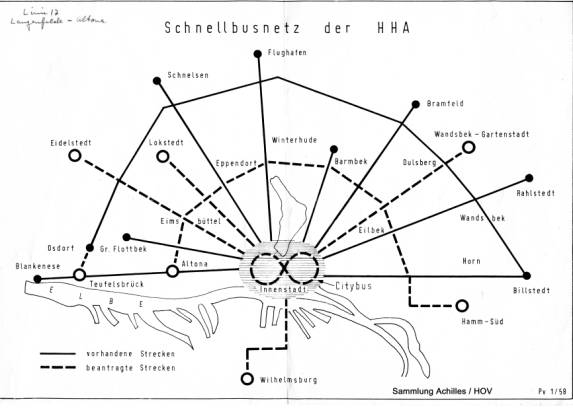
Die Erweiterungsplanungen für den Schnellbus gibt die obige Übersicht von 1958 wieder. Der über Jahrzehnte
bekannte „Schnellbus-Pfeil“ wurde zu dieser Zeit an den Bussen, in
Publikationen und an den Haltestellen als Wiedererkennungs-merkmal eingeführt.
Auf diesem Plan sind bereits die Linien 31 (Flughafen – Billstedt), 32 (Schnelsen – Rahlstedt), 36 (Blankenese –
Winterhude) und 37 (Osdorf – Bramfeld) in Betrieb. Die einst als Schnellbus
projektierte Innenstadt-Ringlinie 30 wurde später mit Kleinbussen, den
City-Bussen, betrieben – siehe auch „Bild des Monats Juni 2008“ in unserem
Archiv.
In den nächsten Jahren wurde das SCHNELLBUS-Netz weiter
ausgebaut und aufgrund der guten Nachfrage der Takt auf einzelnen Linien in den
Hauptverkehrszeiten auf 10 bzw. 7 1/2 – Minuten verdichtet. Auch die
Betriebszeiten der einzelnen Linien änderten sich. Eine Besonderheit war
bisher, dass an Sonn- und Feiertagen auf einzelnen Schnellbuslinien der Betrieb
ruhte. Der Sonntagsbetrieb wurde nun auf immer mehr Linien eingeführt, so z.B.
ab Mai 1960 auf der Linie 34. Der werktägliche Tagesbetrieb begann meist
zwischen 6 und 7 Uhr am Morgen und endete dann gegen 21 Uhr, auf der Linie 36
aber erst gegen Mitternacht.
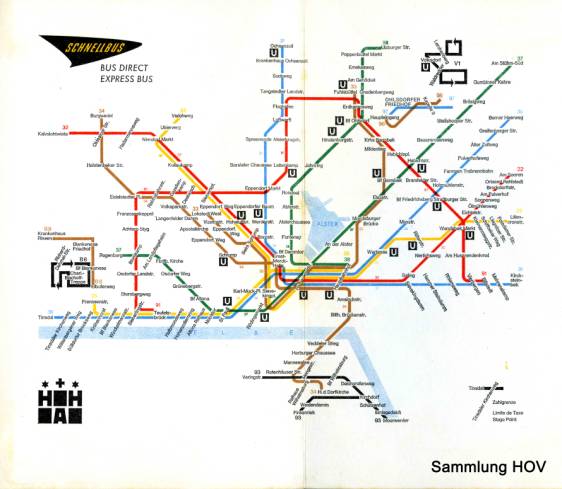
Die obige Übersicht
aus dem HHA-Winterfahrplan 1965/66 gibt das HOCHBAHN-Schnellbus-Netz vor
Beginn des HVV wieder. Auf den Kleinbuslinien galt mittlerweile auch der
Schnellbus-Tarif.
|
22 |
Niendorf – Innenstadt – Hohenhorst |
|
26 |
Tinsdal – Altona – Innenstadt – Hauptbahnhof |
|
31 |
U Ochsenzoll – Flughafen – Innenstadt – Billstedt -
Kirchsteinbek |
|
32 |
Schnelsen (West) – Innenstadt – Rahlstedt |
|
33 |
Lokstedt (West) – Innenstadt – U Fuhlsbüttel |
|
34 |
Burgwedel – Innenstadt – Wilhelmsburg |
|
36 |
Tinsdal – Altona – Innenstadt – Farmsen |
|
37 |
Osdorf – Altona – Innenstadt – Bramfeld |
|
38 |
Poppenbüttel – Harvestehude – Hauptbahnhof / ZOB |
Hinzukamen noch die Sonderlinien 91 Teufelsbrück – Eppendorf – Billstedt und die Linien 96 und 97 auf dem Hauptfriedhof Ohlsdorf. Bei der Schnellbuslinie 26
handelte sich um die seit dem 01.11.1964 bestehende Verstärkungslinie zur Linie
36.
Am 02.01.1967 trat der erste HVV-Gemeinschaftsfahrplan in
Kraft. Es ergaben sich Veränderungen im Schnellbusangebot. Die VHH-Linie 1
Lauenburg - Geesthacht - Bergedorf - Billstedt - Hbf./ZOB wurde als Linie 21 in das Schnellbussystem integriert.
Gleichzeitig wurde auf dem westlichen Abschnitt der Linie 37 das Fahrtenangebot
zugunsten der Normaltarif-Omnibuslinien 87 und 187 sowie der S-Bahn reduziert.

Weiter kam die seit 1952 mit Bahnbussen betriebene Linie
Hauptbahnhof/ZOB - Harburg, Rathaus als Linie 46 hinzu. Im Oktober 1970
wartet der Bahnbus DB 25-815 (Büssing BS 120 N) auf seine nächste
Fahrt vom ZOB Hamburg nach
Harburg.
Der Sommerfahrplan 1967 brachte die Einstellung der
Verstärkerlinie 26, ab September 1967 wurde die Linie 33 zu einer reinen
Hauptverkehrszeitlinie herabgestuft. Zum
Sommerfahrplan 1968 verlor diese Linie den Abschnitt Rathausmarkt -
Fuhlsbüttel. Kurz vorher war die Linie 22 innerhalb Niendorfs nach
Niendorf-Nord verlängert worden.
Die am 29.09.1968 erfolgte Umzeichnung der Linie 91 in 39 zeigte nun auch nach außen die
Integration dieser Linie in das Schnellbussystem.
Noch heute ist die 40er-Liniennummergruppe den im Raum
Harburg verkehrenden Stadtbuslinien vorbehalten. Die konsequente Umstellung der Stadtbuslinien im
HVV von zwei- auf dreistellig erlaubte es nun, die zweistelligen 40er-Nummern
dem Schnellbussystem zuzuordnen. Die beiden Blankeneser Kleinbuslinien (48 und
49) und die Kleinbuslinie in Volksdorf (47) wurden mit ihrer Liniennummer so
erkennbar in das Schnellbussystem eingegliedert, obwohl hier der Schnellbustarif
schon seit längerem galt. Bis zum 27.09.1969 waren auch die beiden Sonderlinien
96 und 97, die auf dem Friedhof Ohlsdorf verkehrten, mit ihren neuen
Liniennummern 42 und 43 in dieses System eingefügt. Auch hier galt der
Schnellbustarif, ansonsten waren diese beiden Linien aber nicht
schnellbustypisch, weil auf ihnen normale Stadtbusse verkehrten und die
Haltestellenabstände sehr kurz waren. Zum Winterfahrplan 1969/70 wurden sie in
die Stadtbuslinien 170 und 270 umgewandelt, der Zuschlag entfiel.
Am 01.06.1969 erfuhr das Schnellbusnetz mit der neuen Linie 30 eine Erweiterung. Zwischen
Hauptbahnhof und Landungsbrücken diente diese Linie als Zubringer zur
Englandfähre. Die Betriebszeiten waren auf die Fährverbindung abgestimmt. Ein
Jahr später fungierte die Linie auch als Zubringer zur Norwegenfähre.
Eine Veränderung der Verkehrsführung in der Innenstadt
brachte ab 23.05.1971 die Einführung von seitlichen Bussonderspuren in der
Mönckebergstraße. Die Linienführung der Schnellbusse über Rathausstraße -
Speersort - Steinstraße wurde aufgegeben.
Am 26. und 27.09.1971 konnten Fahrgäste der Linie 37 zwei
Elektrobusse nutzen, die zu Versuchszwecken in Hamburg weilten:
DAIMLER-BENZ
OE 302 (Hybridantrieb)
MAN 750
HO-M10 (mit Batterieanhänger)
Insbesondere der MAN-Bus fiel aber dadurch auf, dass er
nicht immer die Endstelle erreichte. Auf der IVA 1979 in Hamburg noch einmal
ein Thema, ruhte dann die Weiterentwicklung dieser Technologie in Deutschland
über Jahrzehnte. Aufgrund einer politischen Vorgabe werden erst jetzt nach über
40 Jahren Stillstand Schnellbusfahrgäste Volvo-Busse mit dieselelektrischem
Hybridantrieb im Stadtbusstandard antreffen können, so auch auf der Linie 37.
Hierfür übernahm die HOCHBAHN 2015 von der Tochtergesellschaft Jasper deren
Hybrid-Busse 8368 – 8374 und zeichnete sie in 1476 - 1482 um.
Beginnend in den 1970er-Jahren wurden immer wieder
Abschnitte einzelner Schnellbuslinien durch Normaltariflinien ersetzt und
nachfrageschwache Linien eingestellt. So
entfielen die Schnellbuslinien 32, 33, 38, 46 und 47.

Eine typische Verkehrsszene aus der Mönckebergstraße der
1960er. Auch bei den Schnellbussen hatte die 1968 begonnene Standardisierung
Einzug gehalten. Der Wagen 5802
(Büssing Präfekt 11 Standard) passiert 1968
als Linie 37 die Straßenbahnhaltestelle Gerhart-Hauptmann-Platz, die damals noch von sechs
Straßenbahnlinien bedient wurde. Der schlechte Fahrkomfort führte dazu, dass
schon ab 1969 die erste Schnellbusserie 5801 – 5833 zu Stadtbussen (2801 –
2833) umgebaut wurde. Mit dem Bus 2817 (5817) hat der HOV diesen kurzen
Fahrzeugtyp in seiner Sammlung. Viele Fassaden sind damals von der
Luftverschmutzung und dem Krieg noch stark verschmutzt. Im Hintergrund die am
07.09.1968 eröffnete Fußgängerzone Spitalerstraße.
Ab 01.06.1980 wurde der Rathausmarkt zur zentralen
Umsteigehaltestelle im Schnellbussystem. Abends und an Sonnabendnachmittagen,
sowie ganztägig am Sonntag treffen sich hier – auch heute noch - die
Innenstadtschnellbusse minutengleich.
Zum Sommerfahrplan 1982 verschwand die zum Schnellbustarif
betriebene Kleinbuslinie 49 zum Mühlenberg in Blankenese. Aufgrund von
Protesten wurden einzelne Fahrten durch die Linie 48 übernommen, so dass die
Linie 49 nur auf dem Papier verschwand. Seit 26.09.1999 fanden die Fahrten zum
Mühlenberg wieder unter der Bezeichnung Linie 49 statt. Auch war mittlerweile
die Konzession für die Blankeneser Kleinbuslinien von der HOCHBAHN zur PVG
(heute VHH) übergegangen. Der Schnellbustarif blieb bis heute.
Aber zurück in die 1980er Jahre. Zum Sommerfahrplan 1983
mussten drei Schnellbuslinien ihre Liniennummern ändern. Die 20er-Liniengruppe
wurde aufgegeben, um beim Fahrplanauskunftssystem Verwechselungen mit der
S-Bahn auszuschließen. So sollten künftig nicht der Schnellbus 21 und die
S-Bahn S 21 nach Bergedorf verkehren.
Also wurde aus 21 > 31(II), 22 > 35 und 31 (I) > 38.
Fahrgastzählungen auf den Schnellbuslinien 34 (Schnelsen -
Wilhelmsburg) und 38 (Groß Borstel - Billstedt) ergaben nur noch ein tägliches
Fahrgastaufkommen von 3.900 bzw. 3.500 Personen. Zum Winterfahrplan 1988/89 kam
daher auf politischen Druck das Aus für diese beiden Linien. Da sich das
Fahrgastaufkommen auf den beiden Linien unterschiedlich stark verteilte,
unterbreitete der HVV den Vorschlag, die beiden aufkommensstärksten Linienäste
zu einer neuen Linie 34 Groß Borstel - Innenstadt - Kirchdorf (Süd) zu
verbinden. Die Aufsichtsbehörde lehnte zunächst ab. Erst nach dem politischen
Wechsel an der Behördenspitze konnte inmitten der Fahrplanperiode am 03.08.1992
die Linie 34 in der vorgeschlagenen Form eingerichtet werden.

Als Werbeträger für die neue Verbindung verkehrte der
historische Schnellbus 5702 (Magirus-Deutz
150 R/L 12, Inbetriebnahme 1967) des
HOV den ganzen Tag ohne Fahrgäste auf der Linie 34. Er war mit Girlanden
geschmückt, entsprechend beschriftet und zeigte den über Jahrzehnte (1961-1994)
die Schnellbusse prägenden Farbton Babyrosa. Hier liegt er am Endpunkt Lufthansa-Werft (heute Lufthansa Basis)
in Groß Borstel über.
Bereits zum Sommerfahrplan 1990 wurde die Linie 39 in eine
Linie 38 (Lufthansa-Werft - U-Billstedt) und eine Linie 39 (Flughafen -
Teufelsbrück) aufgespalten, um so die durch den Individualverkehr verursachte
Verspätungsanfälligkeit dieser langen Linie räumlich zu begrenzen. Zum
30.09.1990 erfuhr die VHH-Schnellbuslinie 31 eine Beschleunigung, indem sie ab
Billstedt die B 5 und ab Bergedorf die A 25 nutzte.
Die nur an Fährschiffankunftstagen verkehrende Linie 30 fuhr
ab 02.06.1991 vom neuen Fährterminal Große Elbstraße zum Bf. Altona. Der
Abschnitt zum Hauptbahnhof entfiel, ab 26.09.1992 die gesamte Linie. Eine
Stadtbuslinie zum Normaltarif übernahm das Fahrtenangebot.
Die 1990 vorgenommene Teilung der Linie 39 wurde zum
Sommerfahrplan 1997 zurückgenommen. Die Linie 38 verschwand. In Richtung
Wandsbek fuhr jetzt wieder die Linie 39, allerdings ging der östliche Abschnitt
U-Wandsbek-Markt - U-Billstedt an die neue Stadtbuslinie 213. Zum
Winterfahrplan 1997/98 erhielt die Linie 37 im Bramfelder Raum eine verkürzte
Streckenführung. Seitdem endet die Linie am Bramfelder Dorfplatz, den Abschnitt
nach „Am Stühm Süd“ übernahm der Stadtbus 173.
Mit der Linie 52 gab es ab 01.03.1999 eine neue
Schnellbuslinie in Hamburg. Die
besonders komfortabel und mit Gepäckhalterungen ausgestatteten Omnibusse
der Fa. Jasper boten vom Bf. Altona über Eimsbüttel - Eppendorf einen neuen
Flughafen-Zubringer an. Zunächst im Stundentakt, ab 26.9.1999 auch alle 30
Minuten blieb die Nachfrage aber weit hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht
lag das auch an dem Sondertarif, der über den HVV-Schnellbustarif hinaus
erhoben wurde. Zum 13.12.2003 endete der Betrieb der Linie 52 wieder.
Im Vorfeld der Abschaffung der zuschlagpflichtigen 1.
Wagenklasse in den Zügen der Hamburger Gleichstrom-S-Bahn am 05.11.2000 gab es
im März 2000 ein Prüfungsersuchen der Bürgerschaft an den Senat (Drucksache
16/3852) zu der Frage, inwieweit auch der Schnellbuszuschlag – ohne
beträchtliche Einbußen an Fahrgästen und Einnahmen – entfallen könnte. Hierauf antwortete
der Senat am 07.09.2000 (Drucksache 16/4759), dass „das Schnellbusnetz als
Komfortprodukt mit der hohen Wahrscheinlichkeit auf einen Sitzplatz und der
direkten Anbindung der Innenstadt ohne Umstieg auf die Schnellbahn, die
Zuschlagspflicht in unveränderter Höhe rechtfertige.“ Weiter gab der Senat an,
dass nur zwischen 6 % und 10 % der S-Bahnfahrgäste mit 1. Klasse-Zuschlag auch
den SCHNELLBUS nutzen. „Bei einem Verzicht auf den Schnellbus-Zuschlag wäre
eine erheblich stärkere Nutzung zu Lasten insbesondere der Schnellbahn
zu erwarten, die kostenintensive Angebotsverstärkungen im Schnellbusnetz
erfordern.“
Mit Einführung des Metrobussystems zum Sommerfahrplan 2001
wurden bisher schon gut nachgefragte Stadtbuslinien zu einem eigenen
Verkehrsnetz mit einem an die Schnellbahn angelehnten Takt tagsüber verknüpft.
Diese Omnibuslinien zum Normaltarif erhielten ein- und zweistellige
Liniennummern. Zur Unterscheidung erscheint bei den Schnellbussen bis heute ein
Systemhinweis in der Fahrtzielanlage. Zum 30.09.2001 wurde auf den Linien 36
und 37 das sonnabendnachmittägliche Fahrtenangebot verbessert, um so dem
gestiegenen Einkaufsverkehr Rechnung zu
tragen.
Abgesehen von den Blankeneser Kleinbuslinien, die tariflich
als Schnellbusse gelten, gab die ehemalige PVG im Schnellbussystem nur ein
kurzes Intermezzo. 2001/2002 hatte die PVG insgesamt zwei Kurse auf den Linien
35 und 37 mit Schnellbussen zu bestücken. Zum Einsatz kamen meistens die
komfortabel bestuhlten Wagen 560 und 561, die auch äußerlich mit SCHNELLBUS-Schriftzug
gekennzeichnet waren.
Zum Sommerfahrplan 2004 verlor die Linie 35 den Abschnitt
Schnelsen - Hamburg-Messe ersatzlos.
Die von der Hamburger Aufsichtsbehörde kurzfristig für Mitte
Dezember 2004 verfügte Aufgabe des Streckenabschnittes U-Rödingsmarkt -
S-Bergedorf hätte das Ende der Schnellbuslinie 31 bedeutet. Die
Grundüberlegungen für die Schaffung des Schnellbusnetzes verkennend, wurde nach
Jahrzehnten ein Parallelverkehr zwischen Schnellbahn und Schnellbus erkannt. Da
dieses Vorgehen nicht mit Schleswig-Holstein abgesprochen war, durfte die
angekündigte Aufgabe der Linie 31 nicht umgesetzt werden, der Betrieb dieser
Linie geht bis heute weiter und die von Hamburg erhoffte Einsparung von rd.
500.000 € traf nicht ein. Damit blieb den Fahrgästen auch ein Unikat zunächst
erhalten: Der von Dezember 2003 bis 2007 durch die VHH eingesetzte
Setra-Doppeldecker 0331. Auch hatten die Fahrgäste auf der VHH-Schnellbuslinie
31 die Möglichkeit, auf ihrer langen Fahrt nach Hamburg in den Omnibussen ausgelegte
Tageszeitungen zu lesen.
Wie schon angeführt, soll der Schnellbus komfortable
Verbindungen in die Innenstadt anbieten. Dazu gehört auch ein Sitzplatz, den
jeder Schnellbusfahrgast im Normalfall auch erhält. Das bedeutet ein gegenüber
dem Stadtbus geringeres Fahrgastaufkommen je Fahrt. In den
Bürgerschafts-Drucksachen 19/3241 und 21/186 wurden die Ergebnisse von
Fahrgasterhebungen für 2005 bzw. 2006 und
für 2010 bzw. 2011 mitgeteilt. Danach ergaben sich damit folgende
durchschnittliche Fahrgastzahlen montags bis freitags:
|
Linie |
Einsteiger |
Einsteiger |
Fahrzeugzahl |
|
2005/06 |
2010/11 |
2010 /11 |
|
|
31 |
1.765 |
1.942 |
6 |
|
34 |
2.934 |
1.993 |
10 |
|
35 |
3.099 |
2.865 |
10 |
|
36 |
5.675 |
4.427 |
18 |
|
37 |
8.666 |
7.447 |
24 |
|
39 |
3.723 |
3.036 |
14 |
|
48 |
1.044 |
932 |
4 |
|
49 |
7 |
13 |
Siehe
Linie 48 |
Während die VHH mit ihrer Linie 31 eine leichte Steigerung
in der Nachfrage erreichen konnte, verloren die übrigen Schnellbuslinien nicht
unerheblich. Spitzenreiter blieben aber die Linien 36 und 37. Auffallend ist
dabei, dass bei den beiden Durchmesserlinien deren West- und Ostäste
unterschiedlich stark ausgelastet sind.
|
Linie |
West- |
Ostast |
|
|
36 |
2006 |
2.289 |
3.386 |
|
36 |
2011 |
1.947 |
2.480 |
|
37 |
2006 |
5.543 |
3.123 |
|
37 |
2011 |
4.369 |
3.078 |
2015 und damit unverändert seit 60 Jahren hat Hamburg ein Schnellbusnetz,
doch reicht dieses nach Umfang und Fahrgastaufkommen bei weitem nicht mehr an
das Netz der 1960er Jahre heran. Auch scheint nach Wegfall der 1. Klasse bei
der S-Bahn und der erfolgreichen Etablierung des Metrobusnetzes die Zukunft des
Hamburger Schnellbussystems immer mehr in Frage zu stehen. Aktuell wird wieder
auf politischer Ebene über eine Abschaffung der Schnellbusse diskutiert.
So hat sich die Fahrzeit auf den Schnellbuslinien bis heute
verlängert, z.B. Linie 36 von S Blankenese bis Hauptbahnhof/ZOB nun 43 Minuten
und 21 Haltestellen (1956 = 36 Min. / 15 Hst.). Das liegt an neu eingerichteten
Zwischenhaltestellen, aber auch an den Behinderungen durch den in Hamburg
weitgehend restriktionsfrei fahrenden Individualverkehr. Die Sollzeiten werden
dadurch schnell zur Makulatur an Werktagen sowie bei schönem Wetter mit hohem
Verkehrsaufkommen auf der Elbchaussee. Das Problem hätte dann auch ein Bus zum
Normaltarif.
Wagenpark
Wie schon erwähnt, wird der höhere Fahrpreis auch mit dem
Einsatz komfortablerer Omnibusse begründet. Die HOCHBAHN beschaffte daher
Fahrzeugserien, die einen größeren Sitzabstand und bessere Sitzpolsterung
aufwiesen. Die Musikbeschallung des Fahrgastes während der Fahrt ab 1955 wurde
nach kurzer Zeit wieder eingestellt, weil es negative Reaktionen von Seiten der
Fahrgäste gab. Heute verfügen die HOCHBAHN-Omnibusse wieder über ein
eingebautes Radio. Allerdings dient es nur dem Busfahrer.
Für den im September 1957 in Hamburg stattfindenden UITP-
Kongress zog die HOCHBAHN 16 Schnellbusse aus dem regulären Linienverkehr ab –
Stadtbusse bildeten den Ersatz -, um so die Teilnehmer hochwertig auf
Sonderlinien durch Hamburg und von und zum Flughafen zu befördern.

Mit Einführung des VÖV-Standardlinienbusses I verschwand auch
die typische Dachrandverglasung, die für manchen Schnellbusfahrgast in den
Sommermonaten Schwitzen aufgrund der “wohligen Wärme” bedeutete. Hier ein
Innenfoto von einem Schnellbus
(Magirus-Deutz Saturn II „Typ Hamburg“) aus der Serie 5200 - 5278 (Baujahr
1962), 1963 auf der Reeperbahn unterwegs, links entsteht
gerade das Millerntorhochhaus.
Weitere Ausstattungsmerkmale damals: Keine Einzelsitze, alle
Fahrgastsitze in Fahrtrichtung, ab 1961 Stoffpolster, ab 1965 üppige
Federkernpolster; keine Haltestangen -
höchstens an den Türen – weil stehende Fahrgäste nicht vorgesehen waren. Der
Transport von Kinderwagen bzw.
Rollstuhlfahrern ist erst mit Einführung der Niederflur-Schnellbusse seit 1994
freigegeben.
Die VHH übernahmen später für ihre Linie 21 (31) diese
Kriterien. Das galt auch für die über drei Jahrzehnte gültige Erkennungsfarbe
des Schnellbussystems, dem Babyrosa. Bis 1959 hatten die Schnellbusse die auch
für andere HOCHBAHN-Verkehrsmittel übliche rot-beige Farbgebung. Der
Schnellbus-Prototyp des MAGIRUS-DEUTZ Saturn II (Typ Hamburg) erhielt zunächst
eine Lackierung in dunkelblau-metallic. Von einer Sachverständigen-Kommission
aus Mitgliedern der Hochschule für Gestaltung in Ulm und der Akademie der
bildenden Künste in Hamburg wurde als Erkennungsfarbe das Babyrosa entwickelt.
Alle ab 1960/61 beschafften Schnellbusse erhielten diese Lackierung. Dazu
gehörte auch das als Pfeil ausgebildete Schnellbussymbol. Erst mit der
Fahrzeugserie 6501 – 6584 (Baujahr 1994) verschwand das Babyrosa aus dem Stadtbild
und die Niederflurigkeit mit Platz für Kinderwagen und Rollstühle erhielt
Einzug. Der HOV erhält mit dem Wagen 6502 einen MB O 405 N1 aus dieser Serie.
Die Schnellbusse waren jetzt in weiß mit einer roten Dachbinde gehalten. Seit
2004 weisen die neuen HOCHBAHN-Schnellbusse eine weiß-grau-rote Lackierung auf.
Die VHH veränderten die Farbgebung ab 1987 bis 1993 zu einem kompletten
Babyrosa mit rotem Dachstreifen. Ab 1999 trugen die neu beschafften
VHH-Schnellbusse auch die traditionellen VHH-Hausfarben Schwarz und Rot. Seit
2006 ist Silber die neue Erkennungsfarbe für alle VHH-Busse.
Näheres
unter www.hamburger-fuhrparklisten.de
Umlaufbedingt kommt es bis heute immer wieder vor, dass normale
Stadtbusse auf Schnellbuslinien eingesetzt werden. Ab 2002 beschaffte die
HOCHBAHN Omnibusse mit Klimaanlagen. Weil bis Ende 2004 vergleichbare
Schnellbusse nicht zur Verfügung standen, setzte man an heißen Sommertagen
gezielt Stadtbusse mit Klimaanlage auf den Schnellbuslinien ein.
Umgekehrt kommt der Fahrgast auf Normaltariflinien immer
wieder in den Genuss, mit einem Schnellbus fahren zu dürfen. Auch hier sind
umlaufbedingte Gründe die Ursache. Die Hauptverkehrszeiten im Schnellbussystem
liegen im Vergleich mit den Normaltariflinien später, so dass Verstärkungswagen
nacheinander mehrere Linien bedienen können. Auch besteht derzeit ein Überhang
an Schnellbussen.
Die 2004/2005 beschafften Schnellbusse 6401 - 6420 waren die letzten, die mit einer erheblich komfortableren Innenausstattung aufwarteten. Alle seit 2009 beschafften Schnellbusse weisen im Prinzip die Stadtbusausstattung auf, nur sind die Rückenlehnen etwas höhergezogen und die Polsterung etwas dicker. Die Aufgabe des Schnellbussystems würde also heute fahrzeugtechnisch keine große Umstellung bedeuten. Unverständlich ist in diesem Zusammenhang, dass die außerordentlich komfortablen Flughafenbusse der HOCHBAHN-Tochter Jasper (heute 8320-8326) nach Inbetriebnahme der Flughafen-S-Bahn und der damit verbundenen Einstellung der Airport-Expresslinie 110 nicht dem Schnellbussystem zugeschlagen wurden, sondern auf Stadtbuslinien (überwiegend 112 und 173) „verheizt“ werden.
Text: Lutz Achilles / HOV