
Bild des Monats
Juni 2010
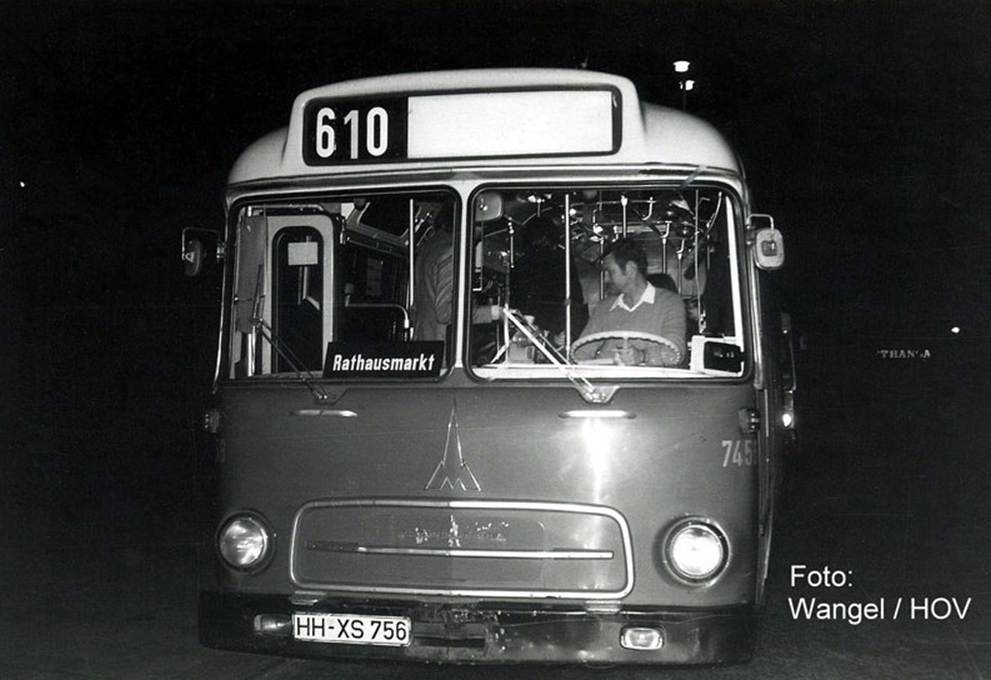
Nachtverkehr
in Hamburg - 40 Jahre 600er-Nachtbusliniennetz
In
vielen Großstädten Deutschlands wird heute auch in der Nacht zwischen 1 und 4
Uhr ein - wenn auch häufig bescheidenes - Fahrtenangebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln
angeboten. Nachtverkehr hat in Hamburg aber schon eine lange
Tradition. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren Pferdeomnibusse
versuchsweise nachts in der Stadt unterwegs. Auch auf der Alster gab es
in den Jahren vor dem I. Weltkrieg nächtliche Schiffsverbindungen vom
Jungfernstieg in die Stadtteile.
In der Nacht zum 05.05.1925 nahm die HHA ihre ersten beiden
Nachtautobuslinien in Betrieb. Damit begann die Epoche eines regelmäßigen
Nachtverkehrs. Schnell folgten weitere Autobuslinien, die die Innenstadt mit
den dicht besiedelten Stadtteilen verbanden. Auch die (damals noch zu Hamburg
gehörende) Nachbarstadt Wandsbek wurde bereits ab 1926 durch die HHA mit in den
Nachtverkehr einbezogen. Die Wagenfolge war im Nachtnetz auf einigen Verbindungen
mit einem 10-Minuten-Takt sehr dicht, in den Nächten von Sonnabend auf Sonntag
gab es sogar einen 7,5-Minuten-Takt. Ab 20.10.1936 wurde das Nachtautobusnetz
um die Straßenbahnlinie 33, die zwischen St. Pauli und Harburg verkehrte,
ergänzt. Nach Inkrafttreten des Groß-Hamburg-Gesetzes und der Übernahme der
VAGA durch die HHA fuhren ab 18.10.1937 erste Nachtbusse von St. Pauli auch
nach Altona. Zu dieser Zeit lag der Schwerpunkt im Nachtliniennetz in St.
Pauli, wurde dieser Stadtteil im Sommer 1939 doch von bis neun Nachtlinien
angefahren.
Der Autobus verlor seine Bedeutung im Nachtverkehr zu
Beginn des II. Weltkriegs als die meisten Nachtbuslinien auf Straßenbahnbetrieb
umgestellt werden mussten und der Autobus nur noch eine Zubringerfunktion zur
Straßenbahn zugewiesen bekam. Die schweren Bombenangriffe auf Hamburg Ende Juli
1943 brachten den regelmäßigen Nachtverkehr für viele Jahre zum Erliegen.
Ausgangs- und Stromsperren in den ersten Nachkriegsjahren
unterbanden einen Nachtverkehr. Nach der Währungsreform im Juni 1948 gab es auf
einigen Straßenbahnlinien einen Spätbetrieb, der aber um 24 Uhr endete. Erst ab
1951 gab es wieder einen Nachtbetrieb. Sechs Nachtstraßenbahnlinien verkehrten
im Stundentakt zwischen 1 und 4 Uhr nachts. Nach Stilllegung der
Straßenbahnverbindung von St. Pauli nach Altona im Mai 1959 kehrte der Autobus
mit der Linie 52 in den Hamburger Nachtverkehr zurück. In den nächsten Jahren
wurde das Nachtnetz immer wieder erweitert, wobei die Straßenbahn, auch
entsprechend dem reduzierten Streckennetz, immer mehr Leistung an den Autobus
abgab. Der Betrieb von Straßenbahn- und Buslinien im Nachtverkehr blieb auch in
den ersten Jahren des Bestehens des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV). Im
Nachtverkehr neu hinzugekommen war die VHH, die mit ihren Nachtbussen im
Hamburger Osten unterwegs war. Mit Ablauf des Winterfahrplans 1969/70 wurde der
Hamburger Nachtverkehr durch neun Bus- und vier Straßenbahnlinien abgedeckt.
Von den insgesamt 13 Linien berührten sieben den Rathausmarkt und sechs Linien
den Hauptbahnhof. Trotzdem bestand für viele Fahrgäste auf ihrer Fahrt
nach Hause die Notwendigkeit, umzusteigen.
Der HVV entschloss sich, zum Sommerfahrplan 1970 den
Nachtverkehr grundlegend umzubauen. Die damals geschaffenen
Liniennetzstrukturen bestehen auch noch heute fort. Es wurde ein besonderes
Netz von Nachtbuslinien mit vom Tagesbetrieb abweichenden Linienführungen
und eigenen Linienziffern (600er) geschaffen. Zentraler Sammel– und
Umsteigepunkt wurde der Rathausmarkt. Den Umsteigeverkehr überwacht zeitweise
Aufsichtspersonal vor Ort. Zusätzlich gab es früher zwei von der Meldestelle im
Hochbahnhaus gesteuerte Lichtsignale am Rathausmarkt und am U-Bahnausgang
in der Mönckebergstraße (bei Karstadt), die den Busfahrern optisch die Abfahrerlaubnis
signalisierten.
Ab der Nacht zum 01.06.1970 entstanden so durchgehende –
vielfach umsteigefreie - Verbindungen in alle Hamburger Bezirke. Das Netz
bestand aus folgenden Linien:
601 Hauptbahnhof –
Rathausmarkt – Altona – Osdorf
602 Rathausmarkt –
Osdorfer Born
603 Rathausmarkt –
Schnelsen
604 Rathausmarkt –
Niendorf
605 Rathausmarkt –
Groß Borstel
606 Rathausmarkt –
Ochsenzoll
607 Rathausmarkt –
Poppenbüttel
608 Rathausmarkt –
Rahlstedt, Großlohe
609 Rathausmarkt –
Bergedorf
610 Rathausmarkt –
Harburg
Als Ergänzungslinien dienten
600 Altona -
Barmbek
617 Barmbek –
Karlshöhe
618 Wandsbek
– Rahlstedt (Ost)
619
Billstedt – Neuschönnigstedt
640 Harburg
– Neu Wulmstorf.
Es
wurde mindestens ein Stundentakt angeboten, auf Teilstrecken fuhr auch alle
halbe Stunde ein Bus. Die Einführung des 600er-Nachtnetzes begleitete der HVV
mit einer Werbekampagne. Ältere Hamburger werden vielleicht noch die farbige,
nackte Schönheit erinnern.
Wie unser Bild des Monats zeigt, konnte man anfänglich auch
ältere Busse beobachten, wie den am 26.09.1970 von Karl-Heinz Wangel am
Rathausmarkt aufgenommenen HHA-Wagen 7456, ein Magirus-Deutz Saturn
II, Typ Hamburg von 1964. Es handelt sich um einen auf dem Betriebshof Harburg
beheimaten Wagen, der zu dieser Zeit das Hamburger Fahrtziel „Rathausmarkt“ in
seinem Fahrtzielband nicht zeigen konnte, stellte doch bis zur Umstellung auf
Bus die Straßenbahnlinie 11 die nächtliche Verbindung zwischen Hamburg und
Harburg sicher. Wie so oft, wenn im Busverkehr neue Ziele hinzukamen, behalf
man sich mit einem Steckschild hinter der Frontscheibe. Mit dem Wagen 7450
erhält der HOV einen Vertreter dieser Serie, übrigens auch ein ehemaliger
Harburger.
In den nächsten Jahren wurde einzelne Linien verlängert,
mit Eröffnung des Elbtunnels 1975 gab es eine neue Verbindung von Altona nach
Finkenwerder (Li. 611). Die Netzstruktur blieb bis heute erhalten, die
Nachfrage insbesondere am Wochenende stieg aber stetig. Vor allem nach
Veranstaltungen in der Innenstadt mussten auf einzelnen Linien immer
wieder Verstärkungswagen aushelfen. Der HVV führte im Herbst 1991 im
Nachtverkehr an den Wochenenden den 15-Minuten-Takt ein. Die Notwendigkeit
zeitweise Verstärkungswagen einzusetzen bestand aber fort. Der Einsatz von
Gelenkbussen blieb aus betrieblichen Gründen die Ausnahme, weil die Fahrer
nachts auch die Fahrscheine der Fahrgäste zu überprüfen haben und die hinteren
Türen bei Gelenkbussen vom Fahrgast geöffnet werden können.
In den 1990er-Jahren wurde das durch HOCHBAHN, VHH und PVG
betriebene Nachtbusnetz – z.T. über die Stadtgrenzen hinaus – durch neue Linien
ergänzt, die aber nur am Wochenende verkehrten. Die Fahrgastzahlen am
Wochenende stiegen weiter. Zum Fahrplanwechsel am 11./12.12.2004 bestand das
Nachtbusnetz aus 33 Linien, von denen allerdings 14 nur den Wochenendverkehr ergänzten.
Zum 17.12.2004 gab es daher eine grundlegende Änderung im
Hamburger Nachtverkehr. Die Schnellbahnen wurden in den Nachtverkehr einbezogen
und bieten seitdem in den Nächten von Freitag auf Sonnabend und Sonnabend auf
Sonntag einen durchgehenden 20-Minuten-Betrieb an. Ergänzt wird das Angebot
durch zahlreiche Buslinien. Neben Metro- und Stadtbuslinien, mit im Vergleich
zum Tagesbetrieb z.T. verkürzten Streckenführungen, verkehren noch zusätzlich
am Hamburger Stadtrand einzelne 600er-Nachtbuslinien.
Die Einbeziehung der Schnellbahnen in den Nachtverkehr
geschah zunächst versuchsweise für ein Jahr. Schon nach kurzer Zeit
verdoppelten sich die Fahrgastzahlen am Wochenende. Heute ist der Einsatz der
Schnellbahnen zur Dauereinrichtung geworden. Auch die anfängliche Beschränkung
auf das Hamburger Stadtgebiet ist heute bei der Schnellbahn nach Einbeziehung
von Norderstedt und Pinneberg aufgeweicht, nachdem sich einzelne
Schleswig-Holsteinische Kommunen am Defizit dieser Strecken beteiligen. Da der
Kreis Stormarn dies nicht tut, endet die U1 auch weiterhin in Volksdorf.
Hinzu kommen in der aktuellen Fahrplanperiode 2009/10 am Wochenende 16 Metro-, 22 Stadtbus- und 13 Nachtbuslinien. Außerhalb des Wochenendes stellen 22 Nachtbuslinien die nächtliche Mobilität in Hamburg sicher.
Text: Lutz Achilles / HOV